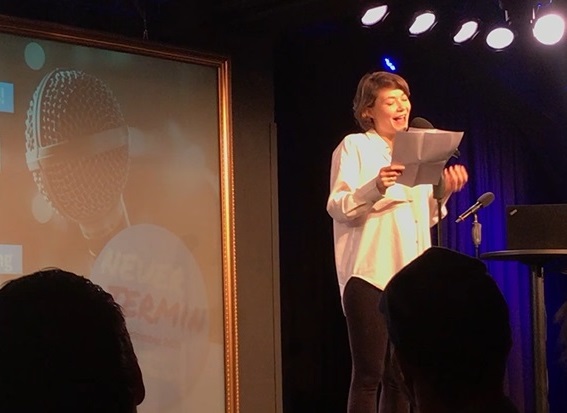„Im Einsatz bin ich mein eigener Chef“: Notarzt Brian, 42, aus den DRK Kliniken Berlin Köpenick
Wir haben im Moment mehrere Jobs für Notärzt*innen an verschiedenen Standorten und mit verschiedenen Erfahrungsleveln anzubieten. Darum haben wir uns gedacht, wir holen uns mal einen Profi aus dem Bereich ins Recruiting Büro und lassen uns etwas darüber erzählen. Anästhesist und Ärztlicher Stützpunktleiter Brian Thiede aus den DRK Kliniken Berlin Köpenick berichtet in diesem ausführlichen Interview offen und ehrlich, was er als Notarzt erlebt, was er an seinem Job am schwersten findet und warum es für ihn trotzdem der beste Job der Welt ist.

Hinweis: Dieser Text enthält Inhalte, die möglicherweise verstörend sein könnten. Wenn Du darüber nachdenkst, Dir das Leben zu nehmen oder mit jemandem reden möchtest – hier findest Du Hilfe: Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 erreichbar.
Aus welcher Motivation heraus wird man Notarzt, ist das nicht sehr stressig?
Notarzt zu sein, hat viele Vorteile. Im Notarzteinsatzfahrzeug ist man sein eigener Chef und kann selbst Entscheidungen treffen. Man kommt aus der Krankenhausatmosphäre heraus an die frische Luft, fährt an einem guten Tag im Sonnenschein durch die Stadt und hat nette Kontakte zu den Jungs von der Berliner Feuerwehr. Auch kann man als Notarzt einen Einsatz nach dem anderen in Ruhe abarbeiten, ohne dass man wegen anderer Fälle unterbrochen wird. Das gibt es sonst nirgendwo – nicht in der Rettungsstelle, nicht auf Station, nicht in der Hausarztpraxis.
Ich persönlich finde die Arbeit in der Klinik oder auf der Intensivstation anstrengender als meine Notarzteinsätze. Auf der ITS betreut man bis zu 25 Patient*innen mit knappen Überlebenschancen und hat oftmals emotional zu knabbern. Als Anästhesist sitzt man, wenn alles nach Plan läuft, acht Stunden in einem OP-Saal ohne Fenster und wartet, dass die Operateur*innen mit der Arbeit fertig werden. Für mich gab es da nach einigen Jahren keine Lernkurve mehr. Insofern sehe ich die Tätigkeit als Notarzt eine spannende Alternative!
Macht es einen Unterschied, ob man in Köpenick oder anderen Bezirken als Notarzt tätig ist?
Eine Besonderheit in Köpenick ist, dass dies ein traditioneller Arbeiterbezirk ist. Und es gibt viele Pflegeeinrichtungen. Man wird häufiger zu Senior*innen mit Brustschmerzen und Luftnot gerufen und seltener zu den lebensbedrohlichen Einsätzen, für die man eigentlich ausgebildet ist. Aber letztere haben wir natürlich auch. Wir nehmen live am Berliner Tagesgeschehen teil, erleben Brände, große Verkehrsunfälle und zum Glück selten Überfälle, Amokläufe oder Terroranschläge. Dort arbeitet man dann als kleines Zahnrad eingebunden in eine große Gruppe aus Mitarbeiter*innen der Feuerwehr, der Polizei, des Sondereinsatzkommandos. Wer so etwas mag, ist meist sehr zufrieden als Notarzt.
Ehrlicherweise muss man natürlich auch über die anstrengenden Seiten sprechen: Durch die vielen Bereitschaftsdienste (bei mir auch im Hubschrauber), die extra bezahlt werden, aber nicht als reguläre Arbeitszeit gelten, habe ich mit meiner 80-Prozent-Teilzeit-Stelle stundenmäßig mitunter eher einen 120-Prozent-Job. Die Arbeit hat sich in den letzten Jahren sehr verdichtet und nach der Corona-Hochphase, in der die Kolleg*innen durchgehalten haben, waren viele erstmal einige Wochen lang krank. Ich finde, man müsste im notärztlichen Bereich noch viel mehr auf Teilzeit-Jobs setzen, denn Teilzeit arbeitende Kolleg*innen sind entspannter und haben mehr Power, um einzuspringen. Der Nachwuchs ist ohnehin sehr auf eine Work-Life-Balance bedacht und das kann man auch verstehen.
Wir bieten Dir aktuell eine spannende Notarzt Stelle im „EMS Fellowship Programm“ der Berliner Feuerwehr an. Was das genau ist und wie Du Dich bewerben kannst, erfährst Du hier!
Hast Du bestimmte Einsätze besonders in Erinnerung behalten?
Ich hatte einen Einsatz, bei dem ein Mann einen Suizidversuch auf den S-Bahn-Gleisen unternommen hatte. Wir mussten zuerst den Strom abstellen lassen, um eine Erstversorgung durchführen zu können. Er lebte trotz abgetrennter Beine und war ansprechbar. Wir gaben ihm Schmerzmittel, forderten den Rettungshubschrauber an. Dann wurde der Strom wieder angestellt, damit die S-Bahn ein Stück weiterfahren konnte und wir den Mann bergen konnten. Er hat überlebt, aber dankbar sind diese Patient*innen für ihre Rettung meist zunächst nicht. Vielleicht kommt die Dankbarkeit nach zwei Jahren Psychotherapie.
Solche Erlebnisse und die Sterblichkeit, die im Krankenhaus unausgesprochen Teil des Alltags ist, führen dazu, dass ich als Notarzt dem Leben selbst wertschätzender begegne. Nach dem Motto „Carpe diem“ versuche ich, wenn ich nach dem Arbeitsalltag noch fit dafür bin, das Leben zu genießen, solange es dauert. Geh raus, triff Dich mit Bekannten, schau Dir die Welt an! Erkenne den Wert von Familie, Freunden, schönen Erlebnissen, Gesundheit und Freizeit! Auf dem Todesbett hat noch nie jemand gesagt: „Hätte ich nur mehr gearbeitet oder mehr Titel gehabt“. Meist geht es um verpasste Zeit, nicht genutzte Gelegenheiten oder unbegründete Ängste.
Wie schaffst Du es, Abstand zu solchen Erlebnissen zu bekommen?
Schlimm ist für mich eher das Gefühl, nicht helfen zu können. Ich habe nach meinem Zivildienst in einem anderen Krankenhaus Erfahrung mit der Pflege von Angehörigen gesammelt und traumatische Situationen erlebt, in denen ich nicht wusste, was zu tun war. Jetzt, nach meinem Medizinstudium und der Qualifikation als Anästhesist und Notarzt, weiß ich es. Als Anästhesist kenne ich mich mit den wichtigsten Lebensfunktionen aus: Lunge und Herz-Kreislauf. 95 Prozent der Fälle bekomme ich allein mit diesem Wissen in den Griff. Ich kann Schmerzmittel geben, Leiden lindern. Manchmal bedeutet helfen auch, das Sterben einfacher zu machen.
Nach einem Einsatz versuche ich mich wenn möglich zu vergewissern, ob ich das Richtige getan habe. Natürlich habe ich im Eifer des Gefechts nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aber haben die Kolleg*innen in der Rettungsstelle oder auf der Intensivstation später noch andere Einschätzungen und Diagnosen getroffen? Wie haben die Jungs von der Feuerwehr oder andere Einsatzkräfte die Situation erlebt? Was kann ich daraus lernen?
Ich bin sehr realistisch und weiß, dass es passieren kann, dass ich eines Tages einen Einsatz fahren werde, der mich so mitnimmt, dass ich sage: Ich kann das nicht mehr. Aber bisher ist der Moment nicht gekommen. Zum Abschalten fahre ich Fahrrad, reise gerne, tausche mich mit meiner Frau aus, die auch Notärztin ist, oder treffe mich mit Freunden. Viele sind auch im medizinischen Bereich tätig, aber auch die Lehrer oder Bibliothekare sind sehr interessiert und fragen nach.
Wir Ärzt*innen unterschätzen Außenstehende oft und nehmen ihnen Entscheidungen ab. Obwohl sie sehr wohl mit medizinischen Themen umgehen können, wenn man sich die Zeit nimmt, ihnen alles zu erklären. Oft bin ich Ansprechpartner im Freundeskreis, dann ruft jemand an: „Meine Frau sitzt mit Schmerzen in der Rettungsstelle!“ Dann beruhige ich: „Na, da ist sie ja genau richtig.“
Du bist Notarzt*Notärztin und suchst nach einer neuen Herausforderung? Komm zu uns in die DRK Kliniken Berlin – alle Infos findest Du hier!
Was wünscht Ihr Euch von Notarzt Bewerber*innen für Euer Team?
Ärzt*innen jeder Fachrichtung können Notarzt werden, wenn sie die entsprechenden Kurse besuchen. Meist sind es Internist*innen, Anästhesist*innen oder Chirurg*innen. Theoretisch kann aber auch ein Neurologe Notarzt werden. Bei uns sind die meisten Anästhesisten.
Seit dem neuen Krankenhausvertrag vom 1. Januar 2021 sind wir eine Verpflichtung mit der Berliner Feuerwehr eingegangen, ihnen jedes Jahr einen gut ausgebildeten Mitarbeiter mit drei Jahren Berufserfahrung als Notarzt in Berlin, das entspricht mindestens fünf Jahren Berufserfahrung in der Facharztweiterbildung, im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung zur Verfügung zu stellen. Das nennt man „Fellowship“. Leider müssen Notärzte in Berlin im Vergleich zu anderen Bundesländern mit Abstand die meisten Voraussetzungen erfüllen.
Wir suchen jemanden, der im Osten Berlins wohnt und verwurzelt ist. Er oder sie sollte teamfähig und in der Lage sein, mit direkten Anweisungen und dem manchmal rauen Ton im Rettungsdienst umzugehen. Die Person darf keine Scheu vor dem echten Leben haben und sollte aufgeschlossen sein. Wir gehen in die Wohnungen der Menschen hinein – in die schmutzige Messie-Bude ebenso wie in das Penthouse am Wasser. Tendenziell häufiger sind es aber Einsätze im sozialschwachen Milieu.
Man sollte sich auch nicht zu fein sein, den Jungs von der Feuerwehr beim Tragen der Ausrüstung zu helfen: Defibrillator, Rucksack mit Medikamenten, Absauggerät, Trage. Auch wenn wir hier in Köpenick fast in einer heilen Welt leben, müssen wir Notärzte immer damit rechnen, in Situationen zu geraten, die uns selbst in Gefahr bringen, zum Beispiel bei einer Amoktat. Was das aggressive Verhalten gegen Rettungskräfte angeht, das die Medien in letzter Zeit häufiger beschreiben, kann ich das für mich hier in Köpenick nicht bestätigen. Wir werden überwiegend als Retter gesehen und wertgeschätzt.
WIRschlagen Dir passende Jobs vor
Nur wenn Du einen der unter „Beruf auswählen“ aufgeführten Berufe gelernt hast und Deine Berufsurkunde vorlegen kannst, kannst Du die Schnellbewerbung nutzen. Wir melden uns dann bei Dir! Mit einem anderen Beruf bewirb Dich bitte über unsere Stellenbörse.